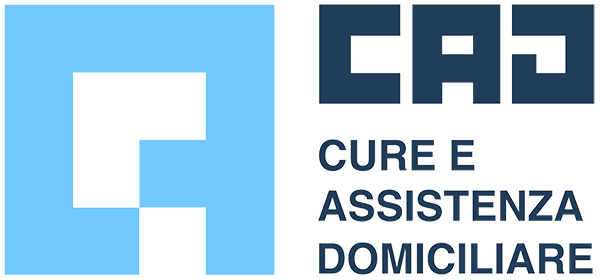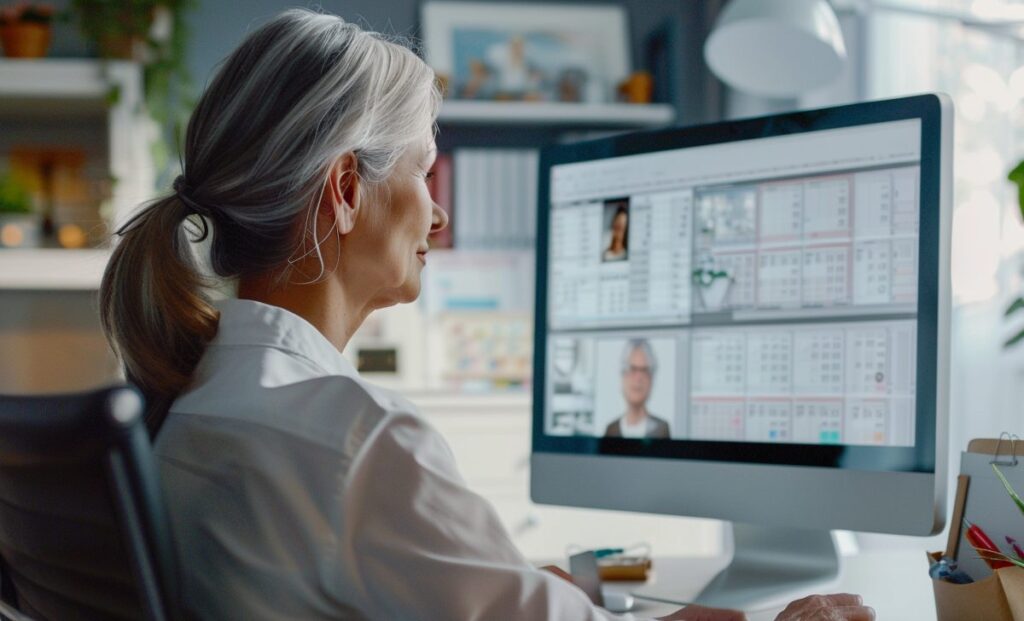Palliative Care zu Hause: Der Mensch im Mittelpunkt
Definition und Ziele der Palliative Care zu Hause
Palliative Care zielt darauf ab, das Leiden von Menschen mit unheilbaren Erkrankungen im fortgeschrittenen Stadium zu lindern und ihnen bis zum Lebensende die bestmögliche Lebensqualität zu bieten. Entgegen einer weit verbreiteten Meinung kommt die Palliativpflege nicht erst in den letzten Lebenstagen zum Einsatz, sondern begleitet den Patienten (und seine Familie) über Monate oder Jahre hinweg, sobald die Krankheit nicht mehr heilbar ist und vor allem eine Symptomkontrolle und umfassende Unterstützung erforderlich sind.
Spezialisierte Dienste für die Palliativpflege zu Hause im Tessin
Im Tessin gibt es zwei Kategorien von Diensten, die auf die Betreuung und das Management von Palliativsituationen spezialisiert sind. Sie sind in Erst- und Zweitlinien unterteilt. Die Erstlinien sind über das gesamte Gebiet verteilt und werden von privaten und öffentlichen SACD (spezialisierte Palliative-Care-Dienste) vertreten, von denen jedoch nur ein Teil über genügend Fachpersonal verfügt, um eine optimale palliative Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Die Zweitlinien sind eine wichtige Unterstützung für die Betreuung und Zusammenarbeit bei der häuslichen Pflege von Patienten, die sich in einer palliativen Behandlung befinden. CAD garantiert personalisiertes Personal, um jede palliative Situation mit Qualität und Präzision zu bewältigen. Für eine optimale Betreuung ist es unerlässlich, eine starke Erstlinie, einen Ärztlicher Bereitschaftsdienst, der alle Bedürfnisse rund um die Uhr abdeckt, und eine Zweitlinie mit konkreter Unterstützung zu gewährleisten.
Ganzheitlicher Ansatz in der Sterbebegleitung
Ihr Ziel ist es, sich nicht nur um die körperlichen Aspekte (Schmerzen, Symptome) zu kümmern, sondern auch um die psychologischen, sozialen und spirituellen Aspekte, die mit dem Lebensende verbunden sind. Sie setzen sich dafür ein, dass der Patient bis zuletzt zu Hause bleiben kann, wenn dies sein Wunsch ist, und gewährleisten dabei Würde und Respekt vor seinem Willen.
Die Achtung des Willens des Patienten in der Palliativpflege
Leitprinzipien der Palliativpflege
In der letzten Lebensphase werden „seine Wünsche und seine Würde“ zu Leitprinzipien der Pflege. Der Patient muss im Rahmen des klinisch Möglichen weiterhin die Entscheidungen treffen, die ihn betreffen. Das bedeutet beispielsweise, den Wunsch zu respektieren, zu Hause statt im Krankenhaus zu sterben.
Viele Menschen äußern diesen Wunsch: in ihrem eigenen Bett, umgeben von ihren Lieben, in einer vertrauten Umgebung sterben zu dürfen. Die Achtung dieser Entscheidungen ist ein wesentlicher Aspekt einer würdigen und unterstützenden Betreuung.
Die entscheidende Rolle der Familie in der palliativen
Die Zustimmung und das Engagement der Familie für die häusliche Pflege spielen eine zentrale Rolle, damit der Patient auch komplexe Symptome zu Hause bewältigen kann. Mit anderen Worten: Wenn die Familie bereit und in der Lage ist, diese Entscheidung zu unterstützen, steigen die Chancen.
Daher ist es von grundlegender Bedeutung, die pflegenden Angehörigen angemessen zu unterstützen, damit sie über die notwendigen Kompetenzen und die erforderliche Unterstützung verfügen, um ihren Angehörigen zu Hause zu versorgen. Wenn der Patient, die Familie und das Pflegeteam auf einer Wellenlänge sind und ein offener Dialog stattfindet, ist es einfacher, alles so zu organisieren, dass der Wille des Patienten respektiert wird.
Die Würde des Menschen bis zum letzten Atemzug
Die Würde wird gewahrt, indem man dem Patienten zuhört und versucht, seine Wünsche (soweit medizinisch möglich) zu erfüllen. Das bedeutet beispielsweise, aggressive Behandlungen, die der Patient nicht möchte, zu vermeiden und sich auf das zu konzentrieren, was ihm wichtig ist: mit seinen Angehörigen sprechen zu können, so klar wie möglich zu bleiben, keine starken Schmerzen zu haben, vielleicht noch einmal einen Sonnenuntergang aus dem eigenen Fenster zu sehen.
Kontinuierlicher Palliativdienst im Tessin
Die häusliche Palliativpflege im Tessin bietet regelmässige und häufige Arzt- und Pflegevisiten, bei Bedarf auch täglich, sowie einen 24-Stunden-ärztlichen Ärztlicher Bereitschaftsdienst rund um die Uhr, um die Sicherheit rund um die Uhr zu gewährleisten. So wird sichergestellt, dass die Symptome jederzeit unter Kontrolle sind (z. B. wird die Schmerztherapie umgehend angepasst) und der Patient nicht wegen Notfällen, die zu Hause behandelt werden können, ins Spital eingeliefert werden muss.
Symptomkontrolle und psychologische und relationale Unterstützung
Eine gute Kontrolle von Schmerzen, Atemnot, Übelkeit und anderen Symptomen ist nicht nur für das körperliche Wohlbefinden, sondern auch für die Würde des Patienten von entscheidender Bedeutung: Sie ermöglicht es ihm, seine Rolle bis zum Ende zu behalten, vielleicht mit seinen Kindern zu sprechen, seine Gedanken auszudrücken und Zuneigung zu empfangen, anstatt von den Schmerzen überwältigt zu werden.
Darüber hinaus helfen Aktivitäten wie Beschäftigungstherapie oder einfaches Gespräch dem Patienten, sich noch lebendig, als Teil der Familie und der Gemeinschaft und nicht verlassen zu fühlen. Triangolo organisiert beispielsweise auch Momente des Austauschs und der Unterhaltung für Patienten und Angehörige (wie die Human Library, in der man sich über Erfahrungen mit Krankheit austauscht), denn auch am Lebensende kann es Momente der Menschlichkeit und bedeutungsvoller Beziehungen geben.
Erfahren Sie mehr über die Vorteile der häuslichen Pflege gegenüber einem Krankenhausaufenthalt
Patientenverfügungen: Entscheidungen für das Lebensende planen
Ein grundlegendes Kapitel in Bezug auf die Achtung des Willens des Patienten sind die vorausgehenden Verfügungen (auch biologische Testament genannt). Vorausgehende Verfügungen sind ein schriftliches Dokument, in dem eine Person, solange sie noch geschäftsfähig ist, erklärt, welche medizinischen Behandlungen sie akzeptiert oder ablehnt, falls sie in Zukunft nicht mehr in der Lage sein sollte, sich zu äußern.
Rechtliche Gültigkeit des biologischen Testaments
In der Schweiz haben Patientenverfügungen volle Rechtsgültigkeit (Art. 370-373 ZGB): Der Arzt ist verpflichtet, sie zu respektieren, sofern ihr Inhalt nicht gegen das Gesetz verstößt (z. B. kann nichts Illegales verlangt werden).
Die Abfassung dieser Verfügung ist ein wichtiges Instrument der Selbstbestimmung, da sie gewährleistet, dass der Wille und die Wünsche hinsichtlich der medizinischen Behandlung von den Angehörigen und dem Pflegepersonal bekannt sind und respektiert werden. In der Praxis bedeutet das Verfassen einer Patientenverfügung, im Voraus Fragen zu beantworten wie: «Wenn ich mich nicht mehr äußern kann und meine Krankheit sich verschlimmert, möchte ich, dass die Ärzte alles tun, um mich am Leben zu erhalten, oder möchte ich lieber auf unnötige Lebenserhaltung verzichten und mich nur auf mein Wohlbefinden konzentrieren?».
Zeitpunkt und Modalitäten für die Erstellung der Patientenverfügung
Die Patientenverfügung sollte rechtzeitig, idealerweise bei guter Gesundheit oder zu Beginn der Krankheit, erstellt werden (warten Sie nicht bis zum letzten Stadium, wenn es möglicherweise zu spät ist). Das Ausfüllen ist ein Recht, keine Pflicht. Sie können jederzeit widerrufen oder geändert werden, solange man noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Sie müssen schriftlich, datiert und eigenhändig unterschrieben sein. Es ist ratsam, sie alle paar Jahre zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie noch den eigenen Absichten entsprechen.
Darüber hinaus ist es wichtig, Ihren Angehörigen oder Ihrem Hausarzt mitzuteilen, wo sie aufbewahrt werden, damit sie bei Bedarf gefunden werden können. Im Tessin betont das Portal Palliative Ticino, dass Dokumente wie Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten es ermöglichen, Behandlungswünsche im Voraus festzuhalten und «sicherzustellen, dass diese von Ihren Angehörigen und Betreuern respektiert werden».
Praxisbeispiel: Einhaltung der Patientenverfügung in der Palliativpflege
Es ist unerlässlich, dass die Würde und Selbstbestimmung des Patienten gewahrt bleiben. Wenn eine Person beispielsweise klar zum Ausdruck gebracht hat, dass sie im Endstadium ihrer Alzheimer-Demenz nicht auf der Intensivstation intubiert werden möchte, helfen die Palliativteams der Familie, diese Entscheidung zu respektieren, und vermeiden unnötige Maßnahmen, die das Leiden nur verlängern würden, ohne einen Nutzen zu haben.
Palliativdienste zu Hause: Fachkräfte und Freiwillige
Im Rahmen der häuslichen Palliativversorgung ist es von entscheidender Bedeutung, Patienten und Familien während des gesamten Krankheitsverlaufs umfassend zu unterstützen, damit viele zu Hause bleiben können und Krankenhausaufenthalte reduziert oder vermieden werden.
Dies geschieht mit Hilfe eines dynamischen interdisziplinären Teams, das in der Regel aus folgenden Personen besteht:
- Onkologen und Palliativmediziner
- Spezialisierte Pflegekräfte
- Psycho-Onkologen
- Psychiater
- Sozialarbeiter
- Freiwillige
Ein wichtiger Aspekt ist die Freiwilligenarbeit: Ausgebildete Freiwillige bieten Präsenz, Zuhören und Gesellschaft für den Patienten und entlasten so auch die Angehörigen für einige Stunden. Dies bereichert die menschliche Dimension der Pflege und verhindert, dass der kranke Mensch aus der Gemeinschaft isoliert wird.
Die Rolle der Palliativmediziner
Einige Einrichtungen bemühen sich um Beratung und fachliche Unterstützung zu Hause, insbesondere durch Palliativmediziner, die die behandelnden Ärzte bei der Kontrolle schwieriger Symptome unterstützen können.
„Seine Wünsche und seine Würde“ ist nicht nur ein Slogan, sondern die Säule, auf der die palliative Pflege zu Hause basiert. Es bedeutet, den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen, ihm zuzuhören und ihn so zu begleiten, wie er es wünscht: Schmerzen lindern, seine Person und seine Werte respektieren, ihn in Entscheidungen einbeziehen (auch durch Instrumente wie Patientenverfügungen) und seine Angehörigen unterstützen. Auf diese Weise kann auch das Lebensende in Ruhe und Erfüllung, in der Wärme des eigenen Zuhauses, umgeben von Zuneigung und mit der kompetenten Unterstützung von Fachleuten, denen nicht nur die Krankheit, sondern der Mensch in seiner Gesamtheit am Herzen liegt,
CAD ist in allen Phasen der häuslichen Pflege tätig, vom Notfall bis zur kontinuierlichen Pflege.
Entdecken Sie unsere Dienstleistungen
FAQ – Häufig gestellte Fragen
Was ist häusliche Palliativpflege?
Die häusliche Palliativpflege ist ein ganzheitlicher Pflegeansatz für Menschen mit unheilbaren Krankheiten, der darauf abzielt, die Lebensqualität durch Symptomkontrolle und psychologische, soziale und spirituelle Unterstützung zu verbessern, damit der Patient in seiner gewohnten Umgebung bleiben kann.
Wie lange kann die häusliche Palliativpflege dauern?
Sie kann je nach Krankheitsverlauf einige Wochen bis zu mehreren Jahren dauern. Sie ist nicht auf die letzten Lebenstage beschränkt, sondern kann bereits bei der Diagnose der Krankheit oder beim Auftreten eines bestimmten Symptoms beginnen.
Wie wird die häusliche Palliativpflege im Tessin aktiviert?
Durch:
- Behandelnder Arzt und/oder Facharzt
- Beurteilung durch das Palliativpflege-Team (Spitex)
- Direkter Kontakt zu Vereinigungen und Einrichtungen, die auf Palliativpflege spezialisiert sind
Warum ist ein multidisziplinäres Team wichtig?
Weil Palliativpflege verschiedene Kompetenzen erfordert:
- Medizinische (Symptomkontrolle)
- Pflege
- Psychologische
- Soziale
- Spirituelle
- Nur ein integriertes Team kann alle Bedürfnisse des Patienten und seiner Familie erfüllen.
Was kann CAD für die Palliativpflege zu Hause tun?
CAD ist in der Region eine kompetente und professionelle Anlaufstelle auch für die Betreuung von Palliativpatienten. Dank seines multidisziplinären Teams und der engen Zusammenarbeit mit den Zweitlinien kann CAD mit Würde und professionellem Respekt jede palliativmedizinische Situation zu Hause nach Wunsch und Einwilligung des Patienten und seiner Angehörigen bewältigen.
Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie CAD Ihnen bei der Palliativpflege und der Beratung und Betreuung in komplexen klinischen Situationen helfen kann.
Quellen und weiterführende Informationen:
- Kern H, Corani G, Huber D et al. Impact on place of death in cancer patients: a causal exploration in southern Switzerland. BMC Palliative Care 19, 160 (2020). (PMC)
- De Brosses K, Sciboz M, Foppa C et al. Quality of outpatient palliative care assessed by direct service observation in Switzerland. Palliative & Supportive Care (in press, 2025). (ScienceDirect)
- Bosshard G et al. Palliative sedation – revised Swiss recommendations 2022. Swiss Medical Weekly 153:w3590 (2023). (smw.ch)
- Käppeli S et al. Digital care conferences in local palliative networks: perceptions of an outpatient team in Switzerland. Swiss Medical Weekly 153:w3487 (2023). (smw.ch)
- Rüesch P, Wagner A et al. Awareness, approval and completion of advance directives among Swiss adults 55+ two years after their legal introduction. Swiss Medical Weekly 147:w14579 (2017). (smw.ch)
- Cavalli S et al. Public attitudes towards advance directives and assisted suicide in Switzerland: a population-based study. BMC Geriatrics 24 (2025). (PMC)
- Bundesamt für Gesundheit (UFSP). Road map per l’attuazione della pianificazione sanitaria anticipata (PSA) in Svizzera. 2024. (Bag)
- https://www.palliative-ti.ch/paziente/questioni-pratiche
- https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/familiari-curanti/prestazioni-e-servizi-per-persone-che-necessitano-di-assistenza/servizi-di-cure-palliative-a-domicilio
- https://www.triangolo.ch/cure-palliative/il-desiderio-di-morire-a-casa/